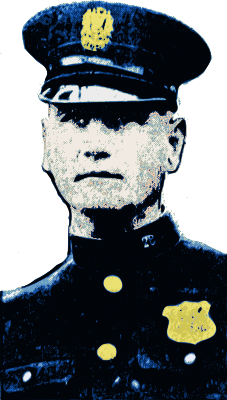Einerseits sind Windkraftanlagen eine umweltfreundliche Art der Energiegewinnung. Andererseits zerstören sie das Landschaftsbild. Gemeinhin wird das auch als „Verspargelung“ bezeichnet. Beim Landgericht Berlin ging es derweil um die Frage von Entschädigung auf Grundlage einer kaufvertraglichen Klausel für die Auftstellung von drei Windrädern auf einem Grundstück.
Einerseits sind Windkraftanlagen eine umweltfreundliche Art der Energiegewinnung. Andererseits zerstören sie das Landschaftsbild. Gemeinhin wird das auch als „Verspargelung“ bezeichnet. Beim Landgericht Berlin ging es derweil um die Frage von Entschädigung auf Grundlage einer kaufvertraglichen Klausel für die Auftstellung von drei Windrädern auf einem Grundstück.
Der Kläger hatte im Mai 2005 in Mecklenburg-Vorpommern solche Flächen mit einer Größe von ca. 71 Hektar von der Beklagten erworben, die als Immobilien-Dienstleister des Bundes den gesetzlichen Auftrag hat, in den neuen Bundesländern gelegene ehemals volkseigene land- und forstwirtschaftliche Flächen zu privatisieren. Maßstab für solche Verträge ist u.a. die Flächenerwerbsverordnung, mit der sichergestellt werden soll, dass die gekauften Flächen längere Zeit ausschließlich landwirtschaftlich genutzt werden.
In § 10 des Kaufvertrages hatten die Parteien Bestimmungen für den Fall vereinbart, dass der Kläger während der ersten fünfzehn Jahre nach Vertragsschluss Flächen ganz oder teilweise als Standort für die Errichtung von Windenergieanlagen o. ä. nutzen möchte. Danach sollte eine vorherige Zustimmung der Beklagten erforderlich und zugleich eine Entschädigung an sie zu zahlen sein, deren Höhe 75 % des auf die Gesamtnutzungsdauer der Anlage kapitalisierten Entschädigungsbetrages betragen sollte.
Der Kläger beabsichtigte 2014, auf einem Teil von ca. 1,41 % der erworbenen Gesamtfläche drei Windräder aufstellen zu lassen. Die über dieses Vorhaben unterrichtete Beklagte forderte daraufhin die Zahlung der gemäß § 10 Ziffer 5 des Kaufvertrages vorgesehenen Entschädigung.
Mit seiner Klage begehrt der Kläger die Feststellung, dass er nicht entsprechend den kaufvertraglichen Regelungen verpflichtet sei, die Beklagte in die Verhandlungen mit einem Energieanlagenbetreiber einzubeziehen und ihr einen kapitalisierten Entschädigungsbetrag zu zahlen.
Das Landgericht Berlin hat der Klage stattgegeben. Die Beklagte hat gegen das Urteil Berufung beim Kammergericht – 28 U 7/15 – eingelegt.
Die kaufvertraglichen Regelungen als Allgemeine Geschäftsbedingungen verstoßen gegen das Verbot einer unangemessenen Benachteiligung gemäß § 307 BGB. Die Flächenerwerbsverordnung sieht nicht vor, dass der Verkäufer an einer der Zweckbindung widersprechenden Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen finanziell beteiligt werden soll. (Landgericht Berlin, Urteil vom 24. Februar 2015 – 19 O 207/14).
Durch die im Kaufvertrag festgelegte Art der Bemessung der Entschädigungsleistung werde der Kläger in einer unangemessenen, ihn möglicherweise sogar in den Ruin treibenden Weise benachteiligt. Denn die Entschädigung solle sich nach der Gesamtnutzungsdauer einer Windenergieanlage errechnen, die regelmäßig einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren umfasse, während die Frist nach der Flächenerwerbsverordnung, innerhalb derer der Erwerber an eine landwirtschaftliche Nutzung gebunden sei, nur 15 Jahre betrage. Auch sei es nicht zumutbar, dass diese sehr hohe – möglicherweise einen Millionenbetrag erreichende – Entschädigung bereits innerhalb von nur einem Monat an die Beklagte zu zahlen sei, während der Kläger von dem Windenergieanlagenbetreiber eine Beteiligung an den Einspeiseerlösen nur in jährlichen Teilzahlungen über einen Zeitraum von 20 Jahren erhalte.
Volltext des Urteils des Landgerichts Berlin: LG Berlin, Urteil vom 24. Februar 2015 – 19 O 207/14