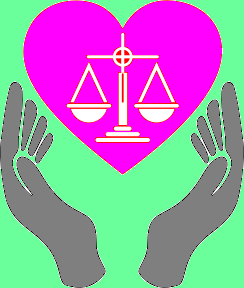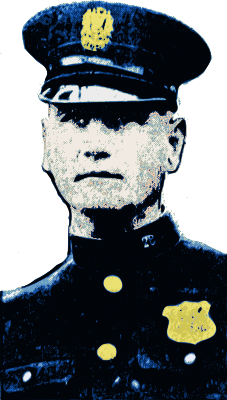Eine Vertriebsmitarbeiterin -geschieden mit zwei Kindern- wurde erneut schwanger. Am 4. Juli 2011 bescheinigte ihr Gynäkologe ein sofortiges, generelles Beschäftigungsverbot iSd. § 3 MuSchG. Ihr Arbeitgeber soll verärgert reagiert haben und sie gedrängt haben, weiter zu arbeiten, was sie aber ablehnte. Bei einer späteren Untersuchung wurde festgestellt, dass die Leibesfrucht abgestorben war. Für den damit notwendigen Eingriff wurde die Klägerin für den 15. Juli 2011 ins Krankenhaus einbestellt. Darüber informierte die Klägerin noch am 14. Juli 2011 ihren Arbeitgeber und teilte mit, dass sie nach dem Eingriff wieder zur Verfügung stehe. Dieser verfasste noch am 14. Juli 2011 eine ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses zum 15. August 2011 „aus betriebsbedingten Gründen“ und ließ diese am Abend desselben Tages in den Briefkasten der Klägerin einwerfen.
Eine Vertriebsmitarbeiterin -geschieden mit zwei Kindern- wurde erneut schwanger. Am 4. Juli 2011 bescheinigte ihr Gynäkologe ein sofortiges, generelles Beschäftigungsverbot iSd. § 3 MuSchG. Ihr Arbeitgeber soll verärgert reagiert haben und sie gedrängt haben, weiter zu arbeiten, was sie aber ablehnte. Bei einer späteren Untersuchung wurde festgestellt, dass die Leibesfrucht abgestorben war. Für den damit notwendigen Eingriff wurde die Klägerin für den 15. Juli 2011 ins Krankenhaus einbestellt. Darüber informierte die Klägerin noch am 14. Juli 2011 ihren Arbeitgeber und teilte mit, dass sie nach dem Eingriff wieder zur Verfügung stehe. Dieser verfasste noch am 14. Juli 2011 eine ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses zum 15. August 2011 „aus betriebsbedingten Gründen“ und ließ diese am Abend desselben Tages in den Briefkasten der Klägerin einwerfen.
Ihre hiergegen gerichtete Kündigungsschutzklage war erfolgreich. Für die Revision noch von Bedeutung war ihr Verlangen nach einer angemessenen Entschädigung gemäß § 15 AGG für die Kündigung, deren Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wurde, jedoch den Betrag von 3.000,00 Euro nicht unterschreiten darf.
§ 15 AGG regelt wie folgt: (1) Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist der Arbeitgeber verpflichtet, den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. (2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der oder die Beschäftigte eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen.
Bei diskriminierenden Kündigungen ist unbeschadet des § 2 Abs. 4 AGG ein Anspruch auf den Ersatz immaterieller Schäden nach § 15 Abs. 2 AGG grundsätzlich möglich. Die merkmalsbezogene Belastung in Zusammenhang mit dem Ausspruch einer Kündigung führt jedenfalls dann zu einem Entschädigungsanspruch, wenn sie über das Normalmaß hinausgeht (BAG, Urteil vom 12. Dezember 2013 – 8 AZR 838/12).
Der Klägerin steht Schadensersatz wegen Diskriminierung nach § 15 Abs. 2 AGG in Höhe von 3.000,00 € zu. Die Kündigung war nach Ansicht des BAG rechtswidrig, da betriebsbedingte Gründe ersichtlich nur vorgeschoben waren und sie tatsächlich jedoch wegen der Schwangerschaft erfolgte.
Nach den Feststellungen des Gerichts war ihr Arbeitgeber verärgert über das Beschäftigungsverbot wegen der Schwangerschaft und drängte die Klägerin zur Weiterarbeit. Damit ist der Kausalzusammenhang zwischen benachteiligender Behandlung und dem Merkmal „Schwangerschaft/Geschlecht“ des AGG gegeben, da die Benachteiligung an die Schwangerschaft anknüpft bzw. durch diese motiviert ist. Ausreichend ist für einen Ersatzanspruch nach dem AGG ist bereits die Vermutung der Benachteiligung. Besteht eine derartige Vermutung für die Benachteiligung wegen eines Grundes baruhend auf einer diskriminieren Benachteiligung, trägt nach die andere Partei (hier: der Arbeitgeber) die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen die Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen hat. Dieser Beweislast konnte der Arbeitgeber nicht nachkommen.
Darüber hinaus ist die Kündigung „zur Unzeit“ erklärt worden. Die Art der Treuwidrigkeit ist wiederum geschlechtsspezifisch diskriminierend. Der Arbeitgeber hätte Rücksicht nehmen müssen und ihr die Kündigung noch vor dem ihm bekannten Krankenhausaufenthalt zukommen lassen müssen.
Volltext des Urteils des Bundesarbeitsgerichts BAG, Urteil vom 12. Dezember 2013 – 8 AZR 838/12