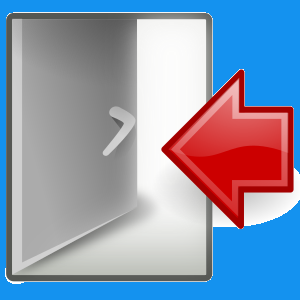Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist zulässig, wenn sie durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor, wenn die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt. In dem folgenden Fall, handelt es sich um den Fall einer Maskenbildnerin, die an einem Theater beschäftigt ist und die Überprüfung der Befristung Ihres Arbeitsverhältnisses verlangt, welches nach Ansicht ihres Arbeitgebers wegen der Eigenart der Arbeitsleistung gerechtfertigt sein soll.
Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist zulässig, wenn sie durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor, wenn die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt. In dem folgenden Fall, handelt es sich um den Fall einer Maskenbildnerin, die an einem Theater beschäftigt ist und die Überprüfung der Befristung Ihres Arbeitsverhältnisses verlangt, welches nach Ansicht ihres Arbeitgebers wegen der Eigenart der Arbeitsleistung gerechtfertigt sein soll.
Die Vereinbarung überwiegend künstlerischer Tätigkeit im Arbeitsvertrag einer Maskenbildnerin an einer Bühne ist geeignet, die Befristung des Arbeitsvertrags wegen der Eigenart der Arbeitsleistung nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 TzBfG zu rechtfertigen.
Die Klägerin war bei dem Beklagten an dessen Theater als Maskenbildnerin beschäftigt. Nach dem Arbeitsvertrag finden auf das Arbeitsverhältnis die tariflichen Bestimmungen des Normalvertrags Bühne (NV Bühne) Anwendung. In dem Arbeitsvertrag ist vereinbart, dass die Klägerin überwiegend künstlerisch tätig ist. Ferner ist vereinbart, dass das Arbeitsverhältnis zum 31. August 2014 befristet ist und sich um ein Jahr verlängert, wenn nicht eine Nichtverlängerungsmitteilung entsprechend § 69 NV Bühne erklärt wird. Der Beklagte sprach im Juli 2013 eine Nichtverlängerungsmitteilung zum 31. August 2014 aus. Die Klägerin hat die Feststellung begehrt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien nicht aufgrund der vereinbarten Befristung am 31. August 2014 geendet hat.
Die Vorinstanzen haben die Befristungskontrollklage abgewiesen. Die Revision der Klägerin hatte vor dem Siebten Senat des Bundesarbeitsgerichts keinen Erfolg. Die Befristung des Arbeitsvertrags ist wirksam. Sie ist wegen der Eigenart der Arbeitsleistung nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 TzBfG gerechtfertigt. Auf der Grundlage des NV Bühne vereinbarte Befristungen von Arbeitsverträgen des künstlerisch tätigen Bühnenpersonals sind im Hinblick auf die verfassungsrechtlich garantierte Kunstfreiheit des Arbeitgebers sachlich gerechtfertigt. Maskenbildner gehören zum künstlerisch tätigen Bühnenpersonal, wenn sie nach den arbeitsvertraglichen Vereinbarungen überwiegend künstlerisch tätig sind.
(Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 13. Dezember 2017 – BAG 7 AZR 369/16; Pressemitteilung Nr. 56/17; Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Köln, Urteil vom 17. Mai 2016 – 12 Sa 991/15)
 Bei Bundestagswahlen kam das d´Hondtsche Höchstzahlverfahren bis einschließlich 1983 zur Berechnung der Sitzverteilung zur Anwendung. Bei Betriebsratswahlen gilt es auch jetzt noch.
Bei Bundestagswahlen kam das d´Hondtsche Höchstzahlverfahren bis einschließlich 1983 zur Berechnung der Sitzverteilung zur Anwendung. Bei Betriebsratswahlen gilt es auch jetzt noch. Eine dynamische arbeitsvertragliche Verweisung auf kirchliches Arbeitsrecht gilt auch nach Betriebsübergang auf weltlichen Erwerber weiter.
Eine dynamische arbeitsvertragliche Verweisung auf kirchliches Arbeitsrecht gilt auch nach Betriebsübergang auf weltlichen Erwerber weiter. Das Arbeitsgericht Berlin hat den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen Air Berlin in vollem Umfang abgelehnt. Die Personalvertretung von Air Berlin wollte unter anderem Kündigungen gegen die Mitarbeiter gerichtlich verbieten lassen.
Das Arbeitsgericht Berlin hat den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen Air Berlin in vollem Umfang abgelehnt. Die Personalvertretung von Air Berlin wollte unter anderem Kündigungen gegen die Mitarbeiter gerichtlich verbieten lassen. Eine im Arbeitsvertrag vereinbarte Verlängerung der Kündigungsfrist kann den Arbeitnehmer gemäß der AGB-Vorschriften unangemessen benachteiligen und daher unwirksam sein.
Eine im Arbeitsvertrag vereinbarte Verlängerung der Kündigungsfrist kann den Arbeitnehmer gemäß der AGB-Vorschriften unangemessen benachteiligen und daher unwirksam sein.